 Penelope Spheeris: The Decline of Western Civilization Part II - The Metal Years (1988)
Penelope Spheeris: The Decline of Western Civilization Part II - The Metal Years (1988)
Film
New Line Cinema
17.06.1988
Blu-ray / DVD
www.declinemovies.com

Mehr Lippenstift, Pose und Schwanz geht beim besten Willen nicht. Nachdem Penelope Spheeris (Wayne's World) sechs Jahre zuvor die Hardcore- und Punkjugend von Los Angeles portraitierte, nimmt sie sich in dieser Rockumentary die Glamrockszene der Stadt vor. Neben Hardrock-Veteranen und damals vielversprechenden Newcomern, kommen auch namenlose Musiker, Fans und Groupies zu Wort. Außerdem gibt es Konzertmitschnitte zu sehen und ein grandioses Interview mit einer Jugendbeauftragten, die sich das De-metalling der Kids zum Ziel gesetzt hat. Up the Irons!, sach ich mal. Dabei gelingt es Spheeris, nicht nur ein musikalisches Genre zu dokumentieren, sondern auch ein Sittenbild der späten 80'er Jahre einzufangen: maßlos hedonistisch, hemmungslos dem Erfolg verschrieben und, ohne es zu ahnen, kurz vor dem Kollaps.
Up the Irons!
Es spricht Bände, dass ausgerechnet Ozzy Osbourne als Stimme der Vernunft erscheint. Interviewt im Bademantel beim Frühstückzubereiten, wirkt er, ganz Elderstatesman des Heavy Metal, am reflektiertesten von allen Befragten. Weder nimmt er sich und seine Rolle ernst, noch das Streben nach Ruhm und Reichtum; schließlich hat er die Chose längst einmal durchexerziert. Ähnlich abgeklärt ist Lemmy Kilmister (Motörhead), der aber sowieso sein Leben lang in einer eigenen Liga gespielt hat. Gene Simmons und Paul Stanley (Kiss), letzterer umschlungen von potentiellen Playboymodels auf ein Himmelbett drapiert, verkaufen erwartungsgemäß selbstverliebt ihre „Wenn du an dich glaubst, kannst du alles erreichen!“ Plattitüden. Die frisch ausgenüchterten Steven Tyler und Joe Perry (Aerosmith) erlebten zu jener Zeit einen zweiten Frühling, weshalb ihnen anzumerken ist, wie sehr sie es noch einmal wissen wollen. Erste Erfolge feierten damals Poison, die zwar selbstbewusst, aber auch überraschend unschuldig rüberkommen, wenn sie beteuern, sie seien nicht "in it for the Money". Beinah erschöpft wirkt hingegen Alice Cooper. Geschminkt und in voller Montur hockt er mit schlaffen Schultern am Bühnenrand vor seiner Guillotine und sagt, auf die Siebzigerjahre angesprochen: „I don't really remember the Seventies.“ Richtige Antwort natürlich. Hundert Punkte. Was? Nichts als Show? Mag sein. Aber genau danach sehnen sich all die aufgebrezelten Kids vom Sunset Strip.
Gefragt, wo sie sich in zehn Jahren sehen, lautet die einhellige Antwort: „I'm gonna be a Rockstar!“ Ein eventueller Plan B steht nicht zur Debatte, als sei allein der Gedanke daran, die beste Vorraussetzung zum Scheitern. Es spielt auch keine Rolle, dass manche von ihnen völlig ungeniert erzählen, wie sie sich von ihren Groupies durchfüttern lassen. In ihrer Vorstellung leben sie längst den Rock n' Roll-Traum. Plattenvertrag, Rolling Stone-Cover und ein Musikvideo in Heavy Rotation auf MTV sind bloß eine Frage der Zeit. Empfindet man als Zuschauer anfangs möglicherweise noch Bewunderung für ihre unerschütterliche Zuversicht, wandelt sich dieses Gefühl bald in ein mildes: 'Ach, Gottchen', und man möchte ihnen (mit äußerster Vorsicht natürlich!) die hochtoupierten Haare tätscheln. „Lern doch lieber was Anständiges, Kind.“
Spätestens wenn Chris Holmes zu Wort kommt, damals Gitarrist von W.A.S.P., entbehrt das Ganze nicht einer gewissen Tragik - und ist doch auf unangenehme Weise brüllkomisch. Eine Wodkaflasche im Anschlag, treibt er in seinem Pool, sieht deutlich älter aus als 29, und berichtet strunzendicht und seltsam verloren von Sexeskapaden, während seine Mutter daneben sitzt und dem Sohnemann beim Schwafeln zuhört. Auf die Frage, weshalb er trinkt, kippt er sich den Rest Wodka über's Gesicht und lallt erstickt: „Cause it makes me … makes me happy.“ Frau Mama ignoriert's geflissentlich. Erst als er sich anschließend als 'Happiest Son of a Bitch' bezeichnet, verzieht sie kaum merklich die Mundwinkel. Ohauahauha. Unweigerlich stellt sich die Frage, ob Glücklichsein nicht vielleicht doch noch anders geht.
Trotzdem wird man den Eindruck nicht los, dass selbst dieses herzzerreißende Kaputtsein oder die ernüchternden Anekdoten mancher Bands die Illusion vom Rockstarsein bei niemandem zerstören können. The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years ist deshalb auch eine Dokumentation über Träume und Sehnsüchte; über den Glauben, dass Erfolg und Anerkennung etwas besser machen. Obwohl sich viele der Interviewten über die oftmals zermürbende Realität des Musikerlebens im Klaren sein müssen, wollen sie es doch unbeirrbar zu etwas bringen, koste es, was es wolle - und ohne zu wissen, was genau dieses Etwas eigentlich sein mag. Ein besseres Leben halt. Irgendwie. Wird schon. Muss ja! Oder? Spoiler Alert: Keine fünf Jahre später bereitete Grunge der Glamszene ein jähes Ende. And that was that. Next, please.
Hmm. Bin ich eigentlich schon wieder zu negativ? Okay. Also: Ich liebe diese Doku. Und zwar seitdem ich 15 war. Im Laufe der Zeit hat sich mein Blick auf die portraitierten Menschen nur immer wieder grundlegend verändert. Anfangs war ich begeistert von ihnen, habe sie gnadenlos angehimmelt, später dann bemitleidet, bevor mich ihr selbstfremder Enthusiasmus schließlich nur noch fasziniert hat. Und genau das ist das Großartige: alle diese Blickwinkel sind möglich. Denn Penelope Spheeris bewertet nicht. Stattdessen lässt sie ihre InterviewpartnerInnen reden und überlässt dem Zuschauer das abschließende Urteil. Aus diesem Grund ist The Decline of Western Civilization Part II: The Metal Years nicht nur Pflichtprogramm, wenn man die Glamszene an sich und ihre Zeit begreifen möchte, sondern auch um herauszufinden, wie sehr man selbst noch an diesen Rock n' Roll-Traum und die damit verbundenen Posen glaubt. HELLO CLEVELAAAAND!!!*
* Unvermeidbare Spinal Tap-Referenz 🙂 Einfach mal googeln.
Endlos lange 80'er Hardrock-Playlist dazu:
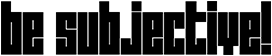
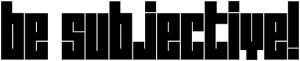
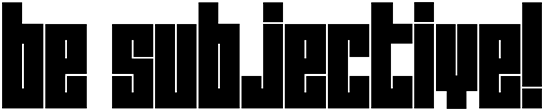




![Video der Woche: Hollywood Vampires – The Boogieman Surprise [kw27/2019]](https://www.be-subjective.de/wp-content/uploads/2019/07/maxresdefault-218x150.jpg)