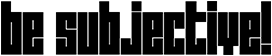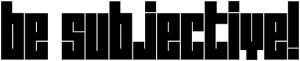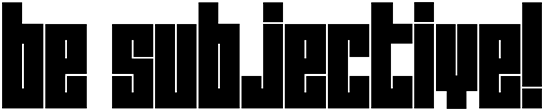„Berlin wat biste groß jeworden!“ mag sich das Ei vom Lande denken, wenn sein Huhn es von der Weide in die Bundeshauptstadt rollt. Nach dem Zita Rock Festival im Sommer führte mich der Weg nun zum zweiten Mal in diesem Jahr in die Deutsche Hauptstadt. Natürlich nicht, um mich beim ollen Steinmeier über das indiskutable Wahlergebnis seiner Partei zu beschweren. sondern, sinnvoller Weise, um den unbestrittenen Königen des Prog-Metal – Dream Theater – einen Besuch abzustatten.
Im Rahmen ihrer Progressive Nation Festival Tour, mit der die New Yorker bereits im August ihre Heimat unsicher machten, hatten sich Mike Portnoy und seine Mannen gleich drei musikalische Schwergewichte ins Boot geholt, von denen zumindest eines auch diesseits des Fast Food Äquators problemlos eine stattliche Halle füllt: Opeth! Dazu gesellten sich als handverlesene Wild-Cardgewinner die Kanadier „Unexpect“ sowie die Retro-Rocker Bigelf. Am frühen Nachmittag in Hannover aufgebrochen, erreichte ich gegen viertel vor Sechs den Tatort. Entgegen der Befürchtung dort in ein heilloses Parkchaos zu geraten, bot sich selbst wenige Meter vor der Halle noch eine freundliche Parkbucht zum Einputten. Geil! Stress ist mal defintiv anders und so nahm ich die Einladung dankend an! Nicht dass sich auf dem Weg zur Arena auch an den Straßenrändern noch zahlreiche Möglichkeiten geboten hätten aber was man hat hat man 😉
Während die Einlassschlange darauf lauerte ins Heiligtum zu gleiten, hielten sich zwei eindeutig englisch sprechende Herren daran schadlos indem sich mit dem Straßenverkauf von mutmaßlich gefälschten Dream Theater-Shirts ein paar Euros hinzu verdienten. Zumindest erschien mir der verlockende Preis von 10 Euro pro Stück als allzu verdächtiges Schnäppchen bei einer Band, die selbst ein Meet & Greet Paket noch für 125 Dollar unter den Hammer bringt. Und der Tonfall den die beiden Herren hier anschlugen verriet, dass sie dies nicht zum ersten Mal machten.
Schließlich in der Halle angekommen, offenbarte sich dem Erstbesucher (in diesem Falle mir) das tatsächliche Ausmaß des Abends. Die Halle, für 7500 Leute ausgelegt, war bereits in der Mitte durch mehrere Mobiletribünen abgeteilt worden, um wenigstens die Illusion einer gefüllten Halle zu erwecken. Zumindest im Bezug auf Unexpect und Bigelf blieb es aber bei dem Versuch. Imposant zeigte sich dagegen die Bühne, welche zur Feier des Headliners fürs erste von der Berliner Molton-Mauer in zwei Hälften getrennt wurde. Wobei es schon bemerkenswert war, wie viel Platz selbst dann noch für die Vorturner übrig war. Zusätzlich hatte man ab beiden Seiten der Bühne noch Leinwände aufgehängt, denen erst im späteren Verlauf des Abends eine größere Bedeutung zukommen sollte.
Eine halbe später als geplant, schickten sich „Unexpect“ erst gegen 19:00 Uhr an den Abend zu eröffnen. Was ihnen nicht ungelegen gekommen sein dürfte, da auf diese Weise noch einige Nasen mehr die Zeit gefunden hatten sich mit dem Getränk ihrer Wahl vor die Bühne zu schieben. Was Opener und Supportacts angeht habe ich im Laufe der Jahre schon eine Menge Schrott ertragen müssen. Erst vergangene Woche erwiesen sich beispielsweise die vorschussgelobten „Kings of Modesty“ als Support von Frau Turunen als posende Rohrkrepierer. Aber „gehn ´mer halt zu Slayer“ (J.B.O.) war gestern, heute griffen die Kanadier zum Ruder und demonstrierten eindrucksvoll, dass es auch anders geht!
Schlag 19:01 Uhr fand die Idylle der Arena ihr gewaltsames Ende als Unexpect für eine halbe Stunde dem Chaos das musizieren beibrachten. Wendungsschwanger, von einem dreckigen Dutzend verschiedener Stilrichtungen befruchtet, legte das Septett eine ganz wilde Sohle aufs Parkett. Dabei durfte man sich wahlweise an die durchgeknalltesten Momente von System of a Down erinnert fühlen, über die mal symphonisch mal folkig anmutenden Streichelemente staunen, die sich wohltuend in das wirre Soundgestrüpp einfügten und für die temperamentvolle Frontrakete Leïlindel am Gesang den Emily Autumn Anstalts-Orden am weißrotenweißen Ringelstrumpf verleihen. Fett!!!
Während das Bühnenambiente vergleichsweise schmucklos daher kam, überzeugte die ungestüme und nicht minder unkonventionelle Show der Kanadier auf ganzer Linie. So kam der Quebec-Siebener trotz unzähliger Expeditionen ins experimentelle immer wieder auf den Punkt, was letztlich die Faszination der Show ausmachte. Gerade weil Unexpect alle paar Sekunden von einer Haut in die nächste schlüpften ohne den Faden zu verlieren, kam so schnell keine Langeweile auf. Ganz zu Schweigen von Bassist „ChaotH“, der sich nicht nur namentlich bestens in die Band einfügte, sondern dabei mit seinem stattlichen 9ender (!!!) buchstäblich wie Kiesel von der Zwille schoss. Mit dieser Power hätten die Que-“Bäcker“ für meinen Geschmack gerne noch das ein oder andere Minütchen dranhängen dürfen.Leider war nach einer Handvoll Songs bereits Schluss und so blieb dem geneigten Auditorium letzten Endes nur der Gang zum Krämerladen, um sich mit Devotionalien und zusätzlichem Material der Band einzudecken. Mit Blick auf den gesamten Abend, soviel sei vorweg genommen, hatten Unexpect in aller Kürze einen super Eindruck hinterlassen und waren – getreu ihrem Namen – unerwartet stark!
Wo Unexpect eben noch mit einem modernen Wildbrett punkteten, folgte mit „Bigelf“ die absolute Spaßbremse! Sicherlich lässt sich über Geschmack streiten, und bei 1500 Menschen in der Halle war bestimmt jemand dabei dem die Amerikaner gefallen haben, doch als Kind der 80´er muss ich neidlos anerkennen: welch eine unsägliche Hippiescheiße! Dabei fing das Quartett so schön an, als sie zum „Imperial March“ die Bühne betraten. Und auch der Plastikyoda auf der Hammondorgel versprühte skurrilen Charme. Doch spätestens als die Bande ewig gestriger Retro-Rocker vollzählig zum Happening angetreten war und Sänger und Keyboarder Damon Fox als „Vadder Abraham“ in die Tasten seiner Käse-Orgel griff, wendete sich das Hanfblatt in Richtung einer bestenfalls solide vorgetragenen Melange aus frühen „Rush“ und der LSD Phase der „Beatles“. Was Vaddi vermutlich entzückt hätte, sorgte zumindest bei mir (und etlichen anderen) auch ohne Rauschmittel zunächst für schwere Lider , direkt gefolgt von eingeschlafenen Füßen. Nur selten offerierten „Bigelf aufregende Momente wie „Hydra“ vom aktuellen Album „Cheat the Gallows“, sodass die allgemeine Lethargie, mit Ausnahme einiger hingebungsvoller Verrenkungen am Hammond Organ, nur in Ausnahmefällen aufgebrochen wurde. Letztlich spielten Bigelf mit ihrem Retrosound völlig gegen den Strom und führten das Motto des Abends – Progressive Nation – ad absurdum!
Während Unexpect sich somit vornehmlich der jüngeren Klientel annahmen, erweckten Bigelf dagegen den Eindruck einer Deep Purple Coverband, die irgendwo in den frühen 70ern hängen geblieben war. Höchste Zeit also für eine Band die das beste beider Welten in sich vereint und sich sowohl in den lauten, als auch den leisen Tönen zu Hause fühlt: Opeth!
Nachdem ich die Schweden dieses Jahr bereits beim Leipziger Wave Gotik Treffen erleben durfte und es ihnen gelungen war einen Kratzer in das meterdicke Packeis zu rocken, welches mich Jahrelang davon abhielt der Band etwas abzugewinnen, war ich gespannt wie sich die Truppe um Frontelch Mikael Akerfeldt in Berlin verkaufen würde.
Da Opeth sich nach den Trantüten von Bigelf und der 20minütigen Umbaupause taktisch unklug in der Setliste vergriffen und ihren Bulldozer mit dem sicherlich stimmungsvollen aber sehr seichten „Windowpane“ gefühlt im dritten Gang anrumpeln ließen, verspielten sie die Chance das Publikum von Beginn an hinter sich zu bringen. Was nicht ist kann ja noch werden, dachte sich der geneigte Zuhörer und erfuhr sogleich den Grund wieso Herr Akerfeldt statt der Treppe mit dem Fahrstuhl das Dachgeschoss ansteuerte: „I´m tired“ gab der Elch zu Protokoll und wenn man genau hinschaute sah man es ihm auch an.
Als Akerfeldt sein Spielgerät für das nachfolgende „The Lotus Eater“ vorbereitete, ergab sich eine dieser erfrischenden Konzertmomente, deren Situationskomik sich schlecht transportieren lässt wenn man nicht selber dabei war. So herrschte im Publikum leises Rascheln und Gemurmel als plötzlich und unerwartet ein Name aus der Mitte scholl: „Mikaeeeel“, rief ein besonders motivierter Fan, worauf jener geradezu beiläufig aufhorchte und ein unschuldiges „Joah?!“ raushaute, als hätte er irgendwas angestellt.
Ohnehin hatte der Opeth Chef heute einen Clown mehr gespätstückt als noch zuletzt und versuchte den Fehlstart mit dosiert eingestreuten Kalauern zu kompensieren. So zog er zwischendurch mal kurz seine „F***ing pants“ hoch, die sich gerade in Richtung halb 8 verabschieden wollten und prahlte dabei, dass er ja „einen unglaublichen Schlag bei Frauen habe“. Vor allem bei älteren Damen…
Musikalisch zog das Tempo im Laufe der Stunde immer mehr an. „The Lotus Eater“ vom aktuellen Album „Watershed“ setzte hier eine erste ernstzunehmende Prog-/Death-Duftmarke, dicht gefolgt von „Reverie/Harlequin Forest“. Hatten Opeth auf den bisherigen Konzerten der Progressive Nation Tour stets das selbe Set aufgefahren, kam Berlin heute in den Genuss einer kurzfristigen Planänderung:: „Hessian Peel“. So berichtete Akerfeldt von der Begegnung mit einem Fan, der sich den von ihm gewünscht hatte. Worauf hin er dies ausdrücklich verneinte. „Tja und kaum war der um die Ecke“, erzählte Akerfeldt weiter, „dachte ich mir: Mensch das wär doch eigentlich eine geile Idee, heute mal Hessian Peel zu zocken!“. Was Opeth schließlich auch taten und dafür ihrem „White Cluster“ eine verdiente Erholungspause gönnten. Der Rest des Show scherte dann aber wieder auf das geplante Gleis ein und offerierte mit „Deliverance“ ein ordentliche Portion Todesblei, dem sich das Publikum bereitwillig hingab, bevor das „F***in´ Masterpiece“ „Hex Omega“ den Reigen beschloss.
Spielerisch hatten Opeth wie gewohnt einiges auf der Pfanne. Da durfte man sich von der unscheinbaren Live-Performance, die obendrein heute ihrer aufwändigen Filmprojektionen beraubt war, nicht täuschen lassen. Dennoch kann ich gut verstehen, dass es auch Besucher gab die mit den komplizierten Schweden nichts anfangen konnten oder von dem langatmigen Einstieg enttäuscht waren. Vor allem durch die verschachtelten Arrangements sind Opeth-Songs in erster Linie mal sperrig wie ein Einbauschrank und ohne vernünftige Einarbeitungszeit kann der Schuss ganz schnell mal nach hinten losgehen. Obwohl die Schweden in Berlin sicher nicht ihren besten Abend erwischten, gelang es ihnen auf die Dauer des Konzerts betrachtet zu überzeugen und damit auf kurzweilige Art das Warten auf den Höhepunkt des Abends zu verkürzen.
Wartezeit war dann auch das Stichwort für den Dream Theater Changeover. Geschlagene 40 Minuten ließen die New Yorker Perfektionisten das Publikum schmachten, bis gegen 10 nach 10 endlich die skurrillen Blasmusikcover bekannter Dream Theater Songs verstummte, das Preludium aus Hitchcock´s „Psycho“ den Spannungsbogen aufbaute, das Licht erlosch und schließlich der Wahnsinn seinen Lauf nahm!
In einem Video-Interview mit dem Fanclub „The Mirror“ hatte Drummer Mike Portnoy ja bereits angekündigt das neue, im Juni erschienene Album „Black Clouds & Silver Linings“ in Europa erst auf der Prog-Nation Tour einer ausgiebigen Live-Taufe unterziehen zu wollen. Dabei konnte es für die Show keinen besseren Einstieg geben als…? Natürlich das 16 Minuten Epos „A Nightmare To Remember“!
Ich gebe es gerne zu, da dies heute mein erstes Dream Theater Konzert war, habe ich vermutlich einen anderen Zugang als der routinierte Stammbesucher, doch was die New Yorker in den kommenden knapp 90 Minuten vom Stapel ließen beschreibt sich (im wahrsten Sinne des Wortes) am besten als „ganz großes Kino“!

Während Blitz und Donner den nahenden Sturm ankündigten und Keyboardsprenkel wie ein einsetzender Regen aus den Boxen tropften, schälten sich auf dem Vorhang die Silhouetten von Petrucci und Myung hervor. Dann eine Sekunde der Stille, bevor der Schleier der Verhüllung im gleißenden Rampenlicht zu Boden fiel und die wilde Fahrt ihren Lauf nahm. Wie schon während des Umbaus durch einen seitlichen Blick zu erahnen, hatten Dream Theater ein stattliches Bühnenbild aufgefahren in dessen Zentrum eine große Leinwand prangte. Für das Publikum links davon: Keyborder Jordan Rudess, der in seiner voll schwenkbaren Kommandozentrale vom Schnurlosen Tastophon bis hin zum Dream Theater Notenhalter einiges an Custom-Spielzeugen aufgefahren hatte und Basser John Myung mit seinem 6saitigen „Bongo“. Zur Rechten ein reichlich bewaldeter John Petrucci nebst 4teiliger Amp-Wall, die jedoch mehr der Zierde diente als dem praktischen Nutzen. Anders dagegen beim Tier der Band, Mike Portnoy! So hatte es sich der alte Pirat nicht nehmen lassen eine Variation seines legendären „Albino Monster“-Kits mit Quicksilver-Finish aufzufahren.
Erinnerte schon der imposante Aufbau, kombiniert aus einem erweiterten Standard-Drumset und einem einem Double Bass Metal-Setup, unwillkürlich an eine fliegende Untertasse, war das was Potnoy damit anstellte schlichtweg galaktisch. Im stehen spielen, mitten im Song das Drumset wechseln, alle 2 Takte etwas anderes spielen, zwischendurch eine Runde ins Mikro growlen und dabei noch Faxen machen – alles kein Problem! Auch wenn er es wohl selber aus Ehrfurcht vor seinen Idolen nie zugeben würde, zählt Mike Portnoy technisch mühelos zu den besten Drummern der Welt und ist im Metal-Bereich ohnehin seit Jahren konkurrenzlos. Wer sagt auch dass der Sänger einer Band zwangsläufig auch der Leithammel sein muss?
Das beste Beispiel hierfür lieferte an diesem Abend James LaBrie. Wobei ich den viel gescholtenen Dream Theater Frontmann insofern in Schutz nehmen muss, als dass es ihm bei den oft mit minutenlangen Instrumental-Soli verzierten Songs nicht gerade leicht gemacht wird Präsenz aufzubauen. Und so begab es sich, dass LaBrie als letzter auf die Bühne schritt, knappe 5 Minuten zu hören war, kurz nochmal das Mikro in die brüllende Meute hielt, um schließlich wieder zu entschwinden. Dieser Vorgang wiederholte sich im Laufe der Show diverse Male und ließ dem Hünen mit der Löwenmähne kaum eine Chance mal richtig aufzubrüllen.
Letzteres war aus Sicht der Show auch gar nicht nötig. Viel zu interessanter war es, die teilweise per Live-Feed auf die Leinwand projizierte Fingerakrobatik der Musiker zu beobachten. Hierzu hatten die Bandmitglieder eine eigene Kamera auf sich gerichtet, welche nicht nur den Zuschauer einem Strudel gleich ins Geschehen saugten, sondern auch von den Musikern zur Selbstdarstellung genutzt wurden. Speziell der großartig aufgelegte Jordan Rudess machte sich einen Spaß daraus, seine Partituren blind in die Tasten zu nageln und dabei noch fröhlich mit der Kamera zu schäkern.
„A Rite Of Passage“ sei Dank, bekam auch James LaBrie wieder etwas Beschäftigung. Auf dem Album, im Schatten der übermächtigen Longtracks etwas unscheinbar, funktionierte des Song live sehr gut und damit eindeutig besser als die Technik. Offenbar hatte hinter den Kulissen niemand den Beamer geprüft sodass die netten Computeranimationen zu gut einem Drittel im Pappmaché der Bühnendekoration verschwanden. Erst nach einige Minuten fand endlich jemand den richtigen Knopf und maß den Projektor korrekt ein.
Von derlei Pannen unbeeindruckt (die Band wird sich erst hinterher über diesen vermeidbaren Faux-pas geärgert haben), nahmen die Jungs anschließend ein wenig das Tempo raus und überließen vorübergehend Jordan das Feld, welcher am Keyboard ein instrumentales Intermezzo einläutete. Anschließend stimmten nacheinander Myung, Petrucci und auch Portnoy mit ein, bis LaBrie in Mitte der Bühne Platz nahm und den „Falling to Infinity“-Schmalztopf „Hollow Years“ anstimmte.
Eindeutig zu den Fun-Parts des Abends gehörte dagegen Jordan Rudess´ Keyboard-Solo. Angespornt von seinem animierten alter ego auf der Leinwand, lieferte der Mann sich ein rasantes Duell bis er letztlich schneller spielte als sein digitaler Schatten! Angefeuert vom Publikum schnallte sich der ruhmreiche Gladiator weiters seine „Key-tuar“um, streifte einen lustigen Zauberhut (Gandalf?!) über und genoss das klimpernde Bad in der Menge! Was für eine Rampensau…!!
Den nachfolgenden Abstecher in die „Awake“-Phase („Erotomania“ & „Voices“) nutzte ich dazu den Flüssigkeitshaushalt aufzufrischen und das „Schlachtendenkmal“ für eine Weile aus der Distanz zu verfolgen. Seitlich der Bühne (nahe der Bratwurstbude) wurde mir vor allem bewusst welchen Knochenjob der Soundmann heute verrichtete. Bedingt durch die Bausubstanz der Arena – eine große kalte Halle, ähnlich der Leipziger Agra oder dem Hangar auf dem M´era Luna (Goten wissen was gemeint ist) – klang alles außerhalb der Publikumstraube wirklich nicht schön! Umso erstaunlicher was der Mann an den Reglern für die Fans noch aus der Nummer heraus kratzte. Sicher, ein bisschen Blech klingt immer aber in Anbetracht der Umstände ging der Sound völlig in Ordnung.

Für Freunde von „Train Of Thought beendete das großartige „In The Name Of God“ eine knappe Viertelstunde lang das reguläre Set der Amerikaner. Doch das eigentliche Sahnestück kam erst noch: „The Count Of Tuscany“. Zum Abschluss des Abends hätten DT keinen passenderen Song auswählen können. 20 Minuten musikalische Genialität zum Einklinken, Abheben und Davonschweben! Darüber hinaus zogen auch die Videoprojektionen nochmal alle Register und erzählten die Geschichte visuell nach. Wahnsinn!
Ganz schön spät und trotzdem viel zu früh verabschiedeten sich Dream Theater gegen kurz vor Mitternacht von einem von Begeisterung beseelten Berliner Publikum. Wenngleich die unzähligen musikalischen Finessen der Songs (Portnoy und Rudess mal ausgenommen) wenig Freiraum für emotionale Ausbrüche gelassen hatten durften die Akteure nun endlich aus sich heraus gehen und zeigen, dass die gute Stimmung im Saal auch an ihnen nicht spurlos vorbei gezogen war. Mit herzlichem Dank und Abschiedsfoto verbeugten sich die Akteure und entließen Berlin in die Nacht!
Was lässt sich mitnehmen von diesem Abend? Zunächst mal, dass es das Räumkommando der Arena unglaublich eilig hatte, die Leute aus der Halle zu kehren. Keine 10 Minuten nach Konzertende kreiste bereits der Besen und fegte die letzten versprengten Seelen aus den Ecken. Das Programm wiederum konnte sich alles in allem sehen lassen. 2 Supports wie sie unterschiedlicher nicht hätten ausfallen können und damit wahlweise die eine oder die andere Hälfte des Publikums begeisterten, Opeth als Co-Headliner mit verschlafenem Einstieg und starkem Finish und zu guter letzt Dream Theater, die auch dann noch in ihrem eigenen Universum spielen, wenn sie nur 75% spielen – bzw. nur 90 Minuten! Mit einem dreistündigen Mammut-Set durfte im Rahmen der Festivaltour ohnehin niemand rechnen! Der Abend war auch so lang genug und ließ genug Resthunger übrig, um sich schon jetzt auf den nächsten Auftritt der New Yorker Prog-Götter freuen zu können. Über das Set des Abends kann man geteilter Meinung sein. Sicherlich hätte es im umfangreichen Repertoire der Band für den ein oder anderen Song noch stärkere Alternativen gegeben, doch allein die gigantischen Longtracks zu Beginn und Ende der Show, sowie das göttliche Keyboardsolo waren bereits den Abend wert! Letztlich halten es Portnoy und Co. als eine der wenigen noch mit Forrest Gump: „Die Setlist ist eine Pralinenschachtel! Man weiß nie was man kriegt!“.
Erschöpft aber glücklich machte ich mich auf den Heimweg durch die Nacht. Die Reise in die Hauptstadt hatte sich gelohnt und Lust auf mehr gemacht. Zu schade nur, dass die Arena wohl ausschließlich der aufwändigen Breitwandproduktion wegen als Austragungsort herhalten musste und somit nicht annähernd gut besucht war. 1500-2000 Nasen mögen es am Ende gewesen sein. Für das Line-Up eigentlich ein Witz! Bleibt nur zu hoffen dass sich die Amerikaner dadurch nicht das Interesse an Deutschland vermiesen lassen und recht bald wieder live zu sehen sind!
r Begriff „erfrischend“ vielleicht etwas merkwürdig im Zusammenhang mit Harsh-Electro klingen mag, das neue Album von Xentrifuge ist genau dies. Man kann Xentrifuge getrost neben bekannte Größen wie Hocico stellen. In diesem Status können sie ohne mit der Wimper zu zucken mithalten.